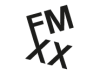Francfort en français- russkiy. Frankfurt auf Französisch- Russisch
Von Dr. Inge Wierda (Kunsthistorikerin)
Im Herbst des Jahres 2017 wurde Frankfurt am Main französisch, da Frankreich Ehrengast der Buchmesse 2017 war.
Ähnliches hatte sich bereits in dem für die Frankfurter Kulturpolitik bemerkenswerten Jahr 1958 ereignet, als über Frankreich deutsch-russische Beziehungen etabliert wurden. Damals bedachten die beiden Kulturstadträte Heinz Vogel und Karl vom Rath den Frankfurter Künstler Eberhard Steneberg sowie einige in Frankreich lebende russische Künstler mit zwei besonderen Aufträgen.

Eberhard Steneberg, Moskau, 1957, Öl auf Leinwand, 49 x 65 cm
Der erste Auftrag
Als Steneberg den Auftrag erhielt, war er gerade von der 6. Internationalen Kunstausstellung im Moskauer Gorki Park zurückgekehrt, wo seine abstrakten Bilder in der russischen Öffentlichkeit für großes Aufsehen gesorgt hatten. Vier Jahre nach Beginn des politischen Tauwetters zwischen West und Ost nahm die jüngere russische Generation die künstlerischen Entwicklungen im Ausland wie ein Schwamm auf. So überrascht es nicht, dass sich nach dieser Moskauer Ausstellung eine Wende in der Kunstwelt Russlands vollzog. Später unterstrich der kürzlich verstorbene non-konformistische Künstler Vladimir Nemuchin (1925-2016), dass jene Ausstellung die in Russland bezüglich fremder Kunst herrschenden Vorurteile zum Erlöschen gebracht hatte.
Nach und nach reifte der Plan, dem deutschen Publikum den vergessenen und doch so wichtigen Beitrag der Russen zur Moderne aufzuzeigen. Im Klima des Kaltes Krieges der 1950-er Jahre war das eine originelle und aufbauende Initiative. Heinz Vogel, der das Vorhaben unterstützte, empfing Steneberg und zwei seiner Freunde in seinem Büro und half dem Künstler bei der Umsetzung.
Im November 1958 besuchte Steneberg zum ersten Mal in Paris lebende russische Avantgardisten. Ziel und Auftrag dieser Reise war die Organisation einer Ausstellung mit russischer Kunst in Frankfurt. Der Kontakt mit den in Paris ansässigen russischen Künstlern Natalya Goncharova, Michail Larionov, El Lissitzky, Ossip Zadkine, Antoine Pevsner, Pavel Mansouroff und Sonia Delaunay-Terk führte rasch zu einer herzlichen und dauerhaften Freundschaft zwischen den deutsch-russischen Künstlern der Moderne. Die im Sommer 1959 im Karmeliter Kloster in Frankfurt am Main gezeigte Ausstellung “Beitrag der Russen zur Modernen Kunst”, mit umfangreichen Leihgaben der russischen Künstler, wurde ein voller Erfolg. Bei den Vorbereitungen war Steneberg insbesondere von der russisch-französischen Malerin und Designerin Sonia Delaunay-Terk unterstützt worden. Die Firma H&C Fermont aus der Schillerstrasse in Frankfurt hatte den Transport der Werke von Paris nach Frankfurt übernommen. Es war die erste Gruppenausstellung russischer Avantgardisten seit 1922/23. Nachdem folgten viele Ausstellungen und Bücher über die russische Avantgarde. Der Katalog, den Steneberg 1959 produzierte, ist in seiner Art aber unübertroffen. Ein Werk und ein Satz sind für alle Aussteller enthalten. In der Einfachheit zeigt sich der Meister!

Marc Chagall: Commedia dell'arte, 1958-63, 2.55 x 4 m, Schauspiel, Frankfurt am Main
(Sammlung der Haeuser-Stiftung für Kunst und Kulturpflege)
Der zweite Auftrag
Im Januar 1958 suchte der damalige Kulturstadtrat Dr. Karl vom Rath Marc Chagall in St. Paul de Vence in Südfrankreich auf, um mit ihm ein Auftragswerk für das Theaterfoyer in Frankfurt am Main zu besprechen. Chagall sagte zu und im Dezember 1958 beschloss die Stadtverordnetenversammlung von Frankfurt, mit Hilfe der Adolf-und-Luisa-Haeuser-Stiftung Chagalls Gemälde “Commedia del’Arte” (Mischtechnik auf Leinwand) und 14 dazugehörige Vorzeichnungen anzukaufen. Seit der Eröffnung der sogenannten "Theaterdoppelanlage" im Jahre 1963 schmücken das 2,55 x 4,00 m große Gemälde und die Skizzen den Chagallsaal des „Schauspiel Frankfurt“. Chagalls Gemälde gilt als ein Sinnbild für das Frankfurt der Nachkriegszeit.
Commedia dell’Arte ist die stimmungsvolle Wiedergabe eines abendlichen Theatererlebnisses von Chagall. In seiner Darstellung fasste der Maler die verschiedenen Aspekte des Theaters zusammen, die er darüber hinaus in stiller, anschaulicher Form kommentierte. Er zeigt die Bühne und das Publikum, den Dirigenten und das Orchester sowie Zirkuskünstler, Musikanten und eine Ballerina. Daneben finden sich typische Bildelemente von Chagall wie die Kulisse einer kleinen Stadt, ein Liebespaar, Fabeltiere, etwa in Form einer fliegenden Ziege, sowie der Kopf eines Hahnes.
Eine Begrenzung des Bildraumes gibt es nicht, jedoch sind die Figuren mit Konturen versehen und die Bühne mit zwei parallel verlaufenen Halbkreisen deutlich erkennbar markiert. Chagalls Assoziationen, seine Erfahrungen und Erinnerungen schweben frei im Raum. Der jüdische Künstler hat vergeben, was geschehen ist, jedoch konnte er nie seinen Geburtsort Vitebsk (die Stadt), seine geliebte Bella, das schreckliche Schicksal des jüdisches Volkes (die Ziege) und seine Familie vergessen. Auch wenn er eine Theateraufführung besuchte, war ihm dies stets gegenwärtig.
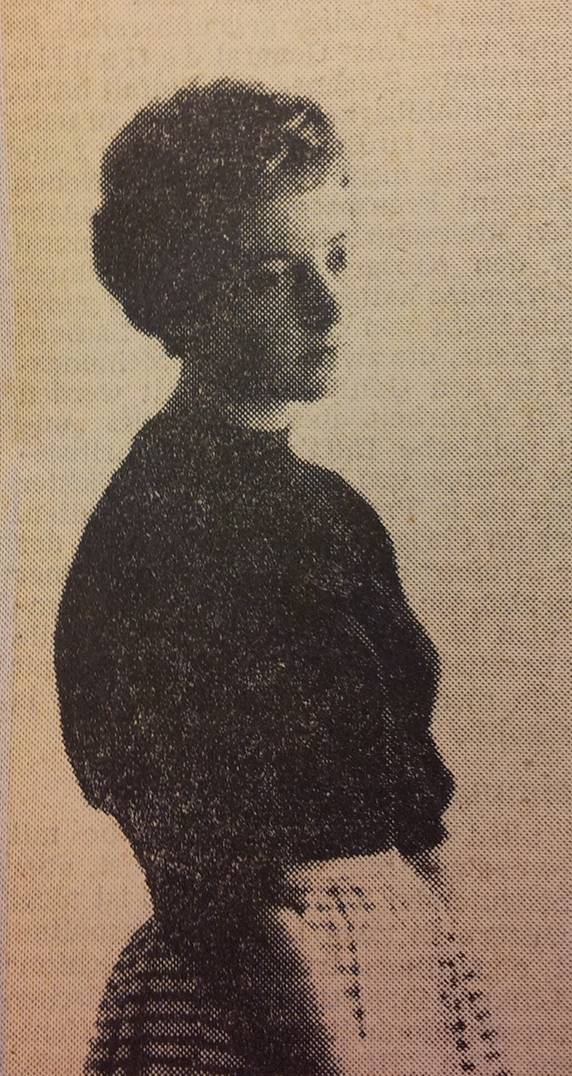
Frau Hanna Lambrette, 1959, Photo in der Zeitung (Frankfurter Neue Presse)
FMXX
In beide Aufträge war die Gründerin des Vereins zur Förderung der Malerei des 20. Jahrhunderts (FMXX), Frau Hanna Lambrette, involviert. In ihrer Frankfurter Werkstatt rahmte sie einige Werke der Russischen Avantgardisten für die Ausstellung “Beitrag der Russen zur Modernen Kunst”. Auch für die Skizzen Chagalls fertigte sie von Hand die Rahmen. Heute werden sie in einer Liste neben der Gemälde in Chagallsaal präsentiert. Ursprünglich betonten die verschiedenen Rahmen der Einzigartigkeit dieser Werke. Begeistert berichtete Frau Lambrette: “Wir hatten ein Abkommen, Herr Vogel und ich. Er rief mich an einem Montagmittag an: 'Wir haben am Freitag die Eröffnung des Chagallsaals. Dafür müssen noch 14 Bilder gerahmt werden.' Ich habe ohne zu schlafen von Montagmittag bis Freitag früh durchgearbeitet.“
Fast 40 Jahre schmückten die Arbeiten Chagalls das Schauspiel Frankfurt, ohne je restauriert worden zu sein. 2004 zeigte das Frankfurter Ikonenmuseum die Arbeiten in ihrer Ausstellung “Als Chagall das fliegen lernte. Von der Ikone zur Avantgarde” und 2017 nahmen sich die Mitarbeiter des Museums erneut der Themen Chagalls an in der Ausstellung „Chagalls Propheten. Die Chagall-Bibel und Ikonen“ (bis 26 November 2017). Doch wer kennt heute noch die anderen Russen die wie Chagall in Frankfurt am Main Geschichte schrieben in den 1950-er Jahren? Archipenko, Delaunay-Terk, Gabo, Gontcharova, Jawlensky, Kandinsky, Lissitzky, Malevich, Mansouroff, Pevsner en Zadkine waren alle 1959 im Karmeliter Kloster in Frankfurt am Main vertreten. Kandinsky, Malevich en Jawlensky Malewitsch und Jawlensky waren bereits gestorben, die anderen lebten meist in Armut, unbekannt in Paris.
Beitrag der Russen zur Modernen Kunst, 1959, Karmeliter Kloster, Frankfurt am Main
Wie eine Nachricht in der Frankfurter Neue Presse zeigt war Alexander Archipenko mit der Skulptur Stehende (1920) vertretet; Sonia Terk-Delaunay mit sechs Ölbilder und 17 Gouachen, Aquarelle und Zeichnungen. Steneberg reiste für Leihgaben von Malewitsch nach Amsterdam. In dem Katalog hatte er Suprematistische Komposition, 1915 aus der Sammlung des Stedelijk Museums veröffentlicht unter dem Titel „Gelb/orange/grün, nach 1914“. Ossip Zadkine schickte über seine eigene Carrier sechs Skulpture nach Frankfurt. Viele von ihnen sind immer noch am selben Ort, wo Steneberg sie zum ersten Mal gesehen hat, im Zadkine-Haus, heute Zadkine-Museum. Natalya Goncharova war sowohl mit vorrevolutionären Werken als auch mit weniger bekannten abstrakten Werken aus den 1950er Jahren vertreten. Von den 19 Ausstellern fasste sie vielleicht das Beste zusammen, was die Russen zur modernen Kunst beigetragen haben. In gebrochenem Deutsch ließ sie Steneberg wissen: „Wir haben als Russen nicht Tahiti. Wir suchten Freiheit – Paris, Berlin, Liberté! Jeder gab, Franzosen, Russen, Deutsche, - aber wir gaben Russland!’
(FMXX, Dez. 2017)
← Zurück